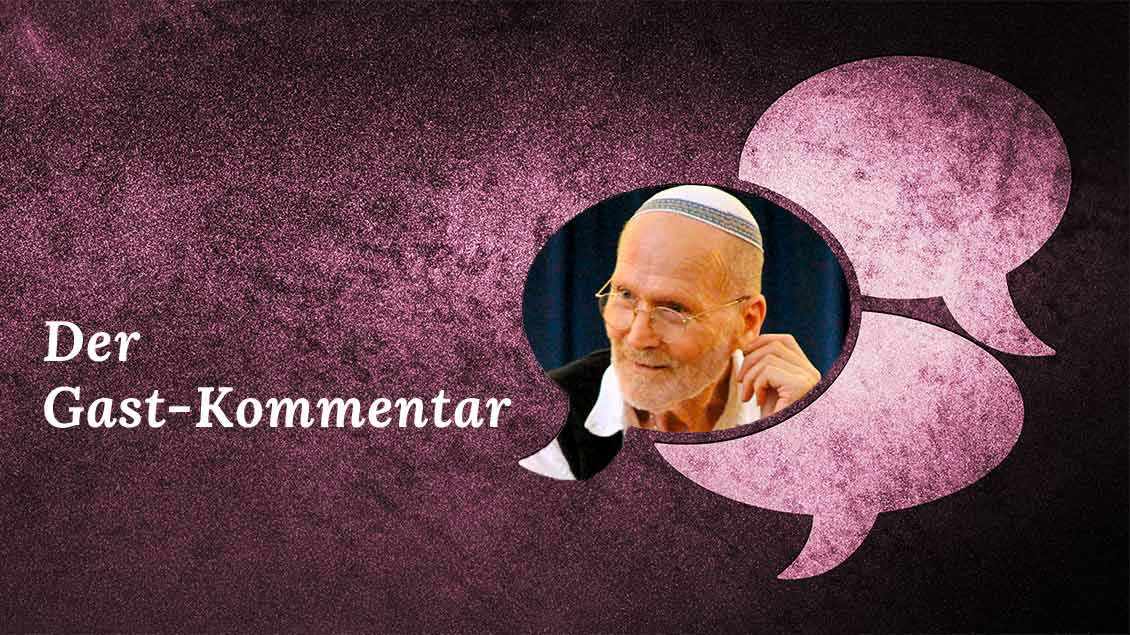Anzeige
Es sind nur zwei Absätze, vielleicht 100 Worte. In dem dicken Buch von Paul Remmeke nimmt ein Lebensabschnitt von ihm wenig Raum ein. „Erinnerungen“ ist der Titel des Bands, den er vor einigen Jahren gemeinsam mit seiner Frau Adelheid zusammenstellte. Fotos, Dokumente, Texte: das Elternhaus in der Kanalstraße in Münster und seine zwei Brüder, seine Schulzeit und Freunde, sein Arbeit bei der Aufzugsfirma Tepper…
Es sind bunte Geschichten, mit Fotos vom Besuch des Nikolaus, von der Radtour mit Arbeitskollegen oder von der Familie zum Weihnachtsfest. Die zwei Absätze aus dem Jahr 1944 aber sind nicht bunt. Sie beschreiben Erlebnisse in einer dunklen Zeit. Remmeke war damals in Auschwitz.
Der Ort, den keiner kannte
Der 92-Jährige war dort weder als Insasse noch gehörte er zum Lager- oder Wachpersonal. Er muss einige Zeit überlegen, bis er die richtige Bezeichnung für seine Aufgabe findet. „Ich war im Kraftwerk des Lagers tätig, habe Hochspannungs- und Elektroanlagen gebaut.“ 16 Jahre war er damals und hatte gerade seine Ausbildung zum Elektriker beendet. In den Kriegsjahren wurde sein Fachwissen gebraucht. Er wurde zum Arbeitsdienst eingezogen und irgendwann von einem SA-Mann abgeholt, der ihn von Münster an einen anderen Einsatzort bringen sollte.

Augen, die viel gesehen haben – Unmenschliches und Menschliches. In Auschwitz erlebte Remmeke Hass und Freundschaft. | Foto: Michael Bönte
„An einen Ort, den keiner kannte und von dem keiner sprach.“ Wieder braucht Remmeke etwas Zeit, bis er seine Erinnerungen sortiert hat. Im seinem Wohnzimmer hat er sein Lebensbuch auf den Tisch gelegt und blättert im Schein des Messingleuchters hin und her. Es ist immer noch das Elternhaus in der münsterschen Kanalstraße, in dem er wohnt.
Die SS war allgegenwärtig
An den Wänden hängen die Bilder seines Lebens – seine Eltern, seine Hochzeit, seine Söhne. Auf den Blättern, die durch seine alten Hände gleiten, sucht er ein Bild, eine Fotokopie oder eine Überschrift, die etwas in ihm wachrufen. Dann weiten sich seine müden Augen, er konzentriert sich kurz und erzählt lebendig und klar.
Er wusste erst, wo er arbeiten sollte, als er die Baracke außerhalb des Konzentrationslagers bezog. „Direkt neben dem Stacheldraht.“ Er wusste aber sofort, dass er über die Geschehnisse dahinter kein Wort verlieren durfte. Und er wusste bald, dass jeder Kontakt zu den Gefangenen verboten war. „Die SS war allgegenwärtig“, sagt Remmeke.
Das Elend war sichtbar
Was vor sich ging, blieb ihm aber nicht verborgen. Wenn er morgens mit seinem Passierschein das Lager betrat, um direkt zur Raffinerie zu gehen, wusste er, dass er einen Ort des Grauens durchquerte. „Das Elend der Menschen war sichtbar.“ Er senkt die Augen und schiebt seine Brille zurecht. „Mir war bewusst, dass jene, die zum falschen Zeitpunkt eingeliefert wurden, schon bald in der Gaskammer sein würden.“
Wie ließ sich das aushalten? „Es war kein Gehorsam“, sagt Remmeke und hebt den Finger. Er selbst stand außerhalb aller Organisationen und Hierarchien im Lager. Jetzt braucht er besonders viel Zeit, das Wort zu finden, mit dem er beschreiben kann, was er erlebte. „Es war Angst“, sagt er und lehnt sich vor. Seine Hände stützen sich auf sein aufgeschlagenes Buch. „Es war die blanke Angst.“
Ein Fehler und er war in Lebensgefahr
Jeder, der nicht das tat, was die SS befahl, war in Lebensgefahr, sagt er. „Ein Fehler – und ich hätte schnell die Seiten wechseln können.“ Von Außerhalb des Stacheldrahts nach Innen. Als Jugendlicher, der sich nach seinem Zuhause sehnte, der nach der Schulzeit und Ausbildung abrupt von Familie und Freunden getrennt worden war, um in einer solchen Kulisse von morgens bis abends schuften zu müssen, hatte er keine Kraft für die Auseinandersetzung mit dem, was um ihn herum geschah. „Auch für mich hieß es, einfach nur zu überleben.“

Paul Remmeke in Uniform: Am Ende des Kriegs kam er an die Front. | Foto: Michael Bönte
Er lehnte sich trotzdem auf. Nur ein klein wenig. Nicht mit dem Gedanken, dass grauenvolle System des Konzentrationslagers unterlaufen zu müssen. Sondern aus Menschlichkeit. Das war sein Charakter.
Ihre Arbeitskraft war ihre letzte Chance
Auch in Münster hatte er noch mit jüdischen Nachbarn gesprochen, als ihn bereits alle davon abrieten. „Vielleicht war ich zu naiv, um das zu verstehen.“ Er senkt den Blink, schließt die Augen und reibt seine Schläfen. „Aber ich konnte einfach nicht anders – es waren doch liebe Menschen.“
Auch als in Auschwitz jeden Morgen die Gefangenen in die Raffinerie marschierten, war ihm das bewusst. Sie kamen, um einfache Wartungs- und Reinigungsarbeiten zu erledigen. „Ihnen schien es gut zu gehen“, erinnert sich Remmeke. „Sie hatten gute Kleidung und ausreichend zu essen.“ Wer in Auschwitz überleben wollte, musste für die Nazis noch einen Wert haben. Ihre Arbeitskraft war ihre letzte Chance. „Die Gesichter wechselten oft und jeder wusste, warum.“
Platz für ein wenig Freundschaft
Ein Gesicht aber blieb – das eines Juden aus Frankreich. „Vielleicht 25 oder 30 Jahre alt.“ Bei der Arbeit, in den Essenspausen oder bei den Aufstellungen zum Appell kam Remmeke mit ihm ins Gespräch. „Nur leise, kurz, sehr vorsichtig.“ Mit der Zeit aber immer geschickter, vor den Wachen verborgen und länger. „Er erzählte mir von seiner Frau in Paris.“ An viel mehr kann er sich kaum erinnern. „Wir haben einfach gequatscht.“ Das tat dem Gefangenen sichtlich gut, sagt Remmeke. „Und mir auch.“ Ein wenig Freundschaft war das. „Nur so viel, wie möglich war.“
Politisches oder gar die Verbrechen im Lager waren nie Themen. „Das war viel zu gefährlich.“ Die Worte, die sie wechselten, waren oberflächlich. Wie ein ganz sanftes Widersetzen, aus Menschlichkeit. Als Remmeke schon nach sechs Wochen zur Front abkommandiert wurde, sprachen sie ein letztes Mal. „Wir einigten uns darauf, keine Namen oder Adressen zu tauschen.“ Auch das geschah aus Angst.
Nie wieder Kontakt
Danach gab es nie wieder Kontakt. „Das macht mich traurig.“ Es hätte die Chance gebracht, einmal anders miteinander zu reden. „Offen, über alles.“ Bis heute bleibt die Ungewissheit, was aus der kurzen Freundschaft geworden wäre. Remmeke kam nach Dänemark, wo er die letzten Monate des Kriegs mit voller Wucht erlebte. Zweimal wurde er verwundet, ehe er nach Münster zurückkehrte. Seine Familie lebte. „Alle, auch meiner Brüder und mein Vater kamen heil zurück – was für ein Glück wir hatten.“
Es dauerte lange, bis er nach Ausschwitz zurückkehrte. In den 1980er Jahren besuchte er die Gedenkstätte zwei Mal. Wie nah das Grauen damals neben seinem Arbeitsplatz geschah, wurde ihm erst da richtig bewusst. Seine Miene verändert sich. So hart wie jetzt war sein Gesicht zuvor nicht. „Das war dort eine riesige Sauerei – schrecklich, unverzeihlich.“
Was hätte er tun können?
Die Frage, ob er sich mehr hätte dagegen auflehnen müssen, überrascht ihn nicht. Er scheint sie sich schon oft selbst gestellt zu haben. „Wie?“, ist seine Gegenfrage. „Ich war doch selbst voller Angst und ohne Orientierung.“ Er blättert schnell durch sein Buch. So, als sei er auf der Suche nach einer bunten Episode seines Lebens, die ihn aus den dunklen Erinnerungen herausholen kann. Raus aus den zwei Absätzen, in denen er die einschneidenden sechs Wochen in Auschwitz zusammengefasst hat.
Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus
Der Tag der Befreiung von Auschwitz am 27. Januar erinnert an jenen Moment, an dem die Rote Armee das Konzentrationslager erreichte. Damals konnten die russischen Soldaten das Ausmaß der Gräueltaten durch die Nationalsozialisten nur erahnen, als sie 650 Leichen vorfanden. Insgesamt wurden in diesem Lager mehr als 1,1 Millionen Menschen ermordet – Juden, Kriegsgefangene, politische Gegner, Sinti und Roma. 2020 jährt sich das Gedenken zum 75. Mal.