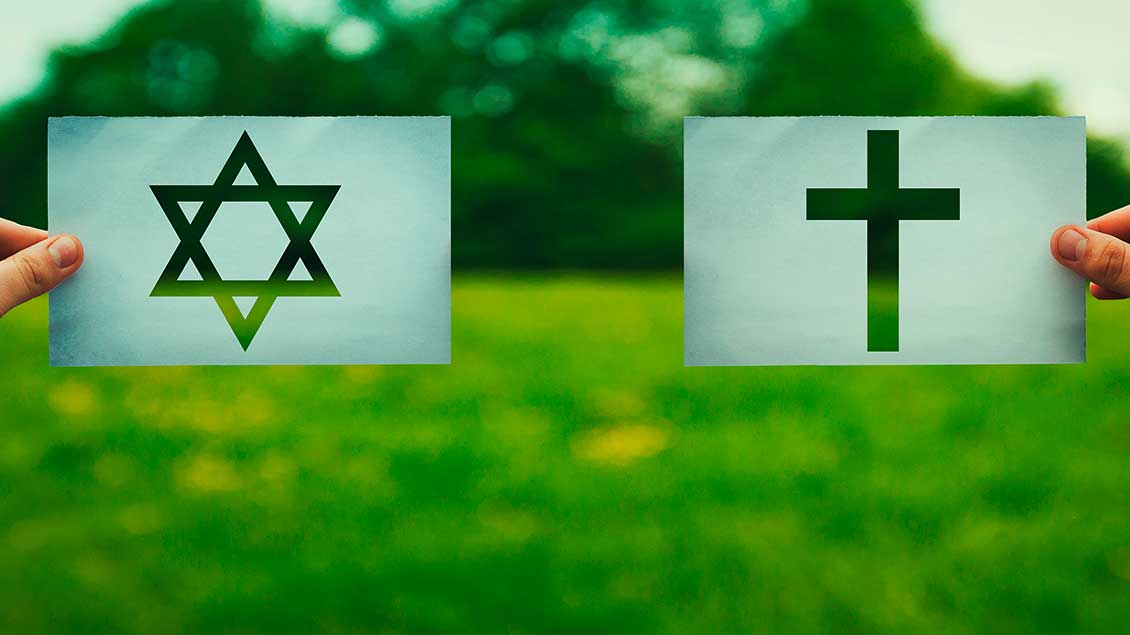Anzeige
Margarita Voloj erfuhr erst als Teenager nach und nach, was ihre jüdische Familie im Holocaust erlebt hatte. Die Judenverfolgung der Nazizeit aber hatte intensive Auswirkungen auch auf ihr Leben. Die Geschichte einer Jüdin der Nachkriegsgeneration.
Sie ist ein typischer Fall für die jüdische Nachkriegs-Generation, sagt sie. Margarita Voloj meint jene Juden, die den Holocaust nicht mehr miterleben mussten. Die in eine Zeit hineingeboren wurde, in der das Grauen des nationalsozialistischen Regimes vorbei war, aber längst noch nicht aufgearbeitet wurde. Das galt nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch für viele jüdische Familien. Die Überlebenden wollten das Erlebte nicht ständig präsent haben. Sie wollten ihre Kinder vor den grausamen Ereignissen schützen. Sie wollten nach vorn schauen.
So war es auch in der Familie von Margarita Voloj. Ihr Großvater war mit Frau und Kindern schon 1933 aus Warendorf nach Kolumbien geflüchtet. Seine Habe als erfolgreicher Viehhändler musste er verkaufen, um die Einwanderung in das südamerikanische Land bezahlen zu können. Dort wurde er zudem gezwungen, zum katholischen Glauben überzutreten. „Das war dort damals so“, sagt die 71-Jährige. Bei der Erinnerung muss sie lächeln. So wie sie es heute oft tut, wenn sie von „damals“ erzählt. Das ist für sie kein Zeichen von Gleichgültigkeit. „Nein, ich sehe durchaus die Katastrophe der damaligen Ereignisse.“ Es gehört aber zu ihrer Wesensart, mit ein wenig Ironie und Sarkasmus davon zu berichten. „Ein paar Tage später hat mein Opa ohnehin alles wieder rückgängig gemacht.“ Die Familie stand aber vor dem Nichts. Ihr Vater sammelte Eier und Orangen, um sie zu verkaufen. Die Großeltern arbeiteten lange und hart, um nach einigen Jahren ein kleines Hotel eröffnen zu können.
Mutter entkommt durch großes Glück der Ermordung
Vertreibung, Armut und Entrechtung – die Familie ihres Vaters meisterte jene Jahre mit Glück und viel Fleiß. Die Familie ihrer Mutter brachte bei ihrer Flucht nach Kolumbien dagegen Traumatisches mit. Sie waren während des Kriegs in ein Konzentrationslager in der Ukraine deportiert worden. „Meine Mutter selbst entkam nur durch großes Glück der Ermordung“, sagt Voloj. „Als sie mit anderen Kindern zum Todestrakt geführt wurde, stolperte sie und fiel in eine Schneewehe, wo sie nicht entdeckt wurde.“ Ein Bauer fand sie und sorgte sich um sie.
Und die kleine Margarita, die 1950 geboren wurde? Die ahnte damals nichts von den Gräueltaten, die den Juden angetan worden waren. Auch die persönlichen Erlebnisse ihrer Verwandten blieben ihr vorenthalten. „Meine Eltern deckten den Mantel des Schweigens darüber – sie wollten uns Kinder nicht belasten.“ Und so wuchs sie in Kolumbien „als Deutsche“ in dem „deutschen Hotel“ ihrer Familie auf, in der die Großmutter rheinischen Sauerbraten servierte. „Wir waren zwar Juden, aber das war für die Kolumbianer nie Thema – weder unser Glaube, noch die Geschehnisse des Holocaust.“
Sie fühlte, dass sie anders behandelt wurde
Das sollte sich für Voloj erst später ändern. Als in den 1950er-Jahren in Münster die jüdische Gemeinde aufgebaut wurde, wollten ihre Großeltern zurück in ihre Heimat. Die Familie von Margarita folgte einige Jahre später, da war sie gerade sieben Jahren alt geworden. In Deutschland spürte sie das erste Mal, dass „irgendetwas passiert sein musste“. Sie sprach nur Jiddisch und stand in der Schule schnell im Mittelpunkt. Auch weil sie nicht Röckchen und Bluse trug, sondern schon Jeans. Sie fühlte, dass sie anders behandelt wurde. „Mit einer distanzierten Hilflosigkeit, so ob mit mir etwas Schlimmes passiert wäre.“
Dazu trug auch das Unvermögen der Lehrerinnen bei, mit der Situation eines jüdischen Kindes im Nachkriegsdeutschland umzugehen. „Als im Geschichtsunterricht über Adolf Hitler gesprochen wurde, musste ich den Klassenraum verlassen“, erinnert sich die 71-Jährige. Und als Menschen anderer Hautfarben im Unterricht als minderwertig bezeichnet wurden, konnte sie das mit ihren Erfahrungen aus Kolumbien nicht in Einklang bringen. „Ich hatte Freunde unterschiedlichster Kulturen gehabt, mein Kindermädchen war dunkelhäutig gewesen.“ Es passte vieles nicht zur Gefühlswelt des Teenagers.
Im Geschichtsunterricht gab es die Nazi-Zeit nicht
Gleichzeitig bemerkte Voloj, dass ihre Mutter mit vergangenen Dingen zu kämpfen hatte. „Wenn sie die deutsche Sprach hörte, begann sie zu weinen“, sagt sie. „Und nachts träumte sie schwer und schrie.“ Die Erlebnisse des Konzentrationslagers hatten sie in Deutschland wieder eingeholt. Nach und nach berichtete sie davon. Manchmal mit einer Ironie, der Margarita zu eigen wurde. Als sie einmal schlechte Noten nach Hause brachte, sagte ihre Mutter: „Keine Sorge, wir haben den Holocaust überlebt, dann überleben wir schlechte Schulnoten auch.“
Margarita Voloj wusste das alles lange nicht einzuordnen. „Kein Wunder, in der Schule wurde direkt nach der Weimarer Republik die Bundesrepublik Deutschland durchgenommen – die Zeit dazwischen schien nicht zu existieren.“ Die Berichte ihrer Verwandten aber erschütterten sie. Richtig nah aber kamen sie nie. „Es bliebt eine innere Distanz zu ihren Erlebnissen“, sagt sie. „Ich hatte das alles nicht selbst erlebt – nur die Auswirkungen auf mein Leben konnte ich langsam einordnen.“ Dazu gehörte vor allem eine große Hilflosigkeit vieler Menschen in der Begegnung mit dem jüdischen Mädchen. Und die Einigelung der jüdischen Gemeinde. „Freizeit, Kultur, Feste – fast alles fand nur im Kreis der Juden in Münster statt.“
Sie wurde „meschugge“
All das machte sie erst verrückt - „meschugge“, wie sie es heute lächelnd auf Jiddisch sagt. Sie wurde aber auch wütend. Die Fragen ihrer Freundinnen nervten sie. „Was esst ihr? Feiert ihr Weihnachten? Wann müsst ihr wieder weg?“ Das fühlte sich für Voloj immer an wie kleine Spitzen. „Die mir vermittelten, dass ich ein völlig anderer Mensch sein sollte – halt eine Jüdin.“
Zum Freiheitsdrang und zur Abenteuerlust von ihr passte diese Reduzierung nicht. „Mit 14 Jahren hielt ich es nicht mehr aus“, sagt sie. „Ich überredete meine Eltern, zu meiner Tante nach Kolumbien zu ziehen, um dort weiter zur Schule zu gehen.“ Dort war sie wieder das Mädchen, das aus Deutschland kam, und nicht das jüdische Kind vor dem Hintergrund des Holocaust.
Erstes Abitur einer Jüdin
Als sie mit 17 wieder nach Münster zurückkehrte, um Abitur zu machen, holte sie dieses Attribut aber sofort wieder ein. „Die Rektorin sagte mir, ich solle mir keine Sorgen machen, dass ich die Prüfungen bestehe“, erzählt Voloj von einem Schlüsselerlebnis. „Sie würden mich als erste Jüdin in der Abschlussklasse des Gymnasiums auf keinen Fall durchfallen lassen.“ Sie war wieder reduziert worden. Sie war in Deutschland Jüdin – sonst nichts.
„Ich habe aus jenen Jahren eine Rastlosigkeit mit in mein Leben genommen“, sagt sie. Sie ging wieder nach Kolumbien, studierte und arbeitete als Lehrerin am dortigen Goethe-Institut. Als ihr Vater schwer erkrankte, kam sie zurück nach Deutschland und wurde Lehrerin an einer Hauptschule in Freckenhorst. Ihre Unrast macht sie gern an einem Beispiel fest: „Mein Mann und ich haben uns in Münster ein schönes Haus gebaut – ich hatte aber noch nie das Gefühl, dass es mein letzter Wohnsitz sein wird.“
Geerbte Fluchtgefühle
Vor einigen Jahren war sie auf einem Seminar in der jüdischen Gedenkstätte Jad Vashem in Israel. Dort sagten ihr die Referenten, dass dieses Gefühl der Unruhe ein typisches Merkmal ihrer Generation sei – vererbt von den Eltern und Großeltern mir Holocaust-Erlebnissen. „Sie berichteten mir, dass viele den Kühlschrank immer bis oben gefüllt haben wollen, weil sie unterbewusst stets damit rechnen, wieder aufbrechen und genug Proviant haben zu müssen.“ Voloj war damals ein wenig erschrocken: „Genau die Eigenart kannte ich von mir.“
Nein, sie leide nicht darunter. Das sagt sie energisch und wieder mit einem ironischen Grinsen. Im Gegenteil: „Meine kleinen Neurosen haben mir die Augen dafür geöffnet, dass ich selbst handeln muss, um an der Situation etwas zu ändern.“ Damit meint sie nicht ihre eigene Lebensqualität, nicht die Aufarbeitung der eigenen Familiengeschichte. Sie meint vielmehr die immer noch bestehende „Verkrampfung der deutschen Gesellschaft mit dem jüdischen Leben“.
Sie will auch Deutsche sein, nicht allein Jüdin
„Es geht nur über Verständigung, über Annährung, über Offenheit.“ Gegenseitiges Verstehen könne nicht per Dekret eingefordert werden, sondern müsse sich in Begegnungen entwickeln. Sie nehme sich dabei selbst in die Pflicht. „Ich kann nicht erwarten, dass andere Menschen mich und mein Leben verstehen, wenn ich auf meinen Rechten poche und auf meinen Standpunkten verharre.“ Sie sei deshalb weit davon entfernt, ihren jüdischen Glauben und die jüdische Geschichte vor sich herzutragen. „Verstehen gelingt nur, wenn ich mich bewege, wenn ich nicht nur als Jüdin auftrete, sondern als Deutsche, die auch Jüdin ist.“
Deshalb bringt sie sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in die Angebote der jüdischen Gemeinde in Münster ein. Jene Gemeinde, die ihr Großvater mit aufbaute. Sie gibt Seminare, macht Führungen, erarbeitet Unterrichtsmaterialien. Sie sagt, dass sie dabei „Klar Schiff“ machen möchte: Eine möglichst große Kontaktfläche zu vielen Menschen schaffen will, damit es nicht mehr die Juden hier und die deutsche Gesellschaft dort gibt, sondern eine große Schnittmenge.
Unruhe hat die Enkelin von der Großmutter
Ihre geerbte Unruhe hilft ihr, am Ball zu bleiben. Eine Unruhe, die sie weitervererbt. Sie sagt das nicht ohne Stolz. Ihre drei Kinder sind ihr ähnlich, haben ihre Heimat in anderen Städten und Ländern gefunden. Sie kennen und lieben die Energie ihrer Mutter. Ihre ironische Art ist ihnen nicht fremd. Vor wenigen Tagen rief ihre Enkelin aus München an. Die Neunjährige sollte ihrer Klasse erzählen, was es heißt, Jüdin zu sein. Die Antwort der Schülerin war „Nein“ gewesen. „Sie wollte nicht allein als Jüdin hervorgehoben werden“, sagt ihre Großmutter. „Das hat sie von mir.“