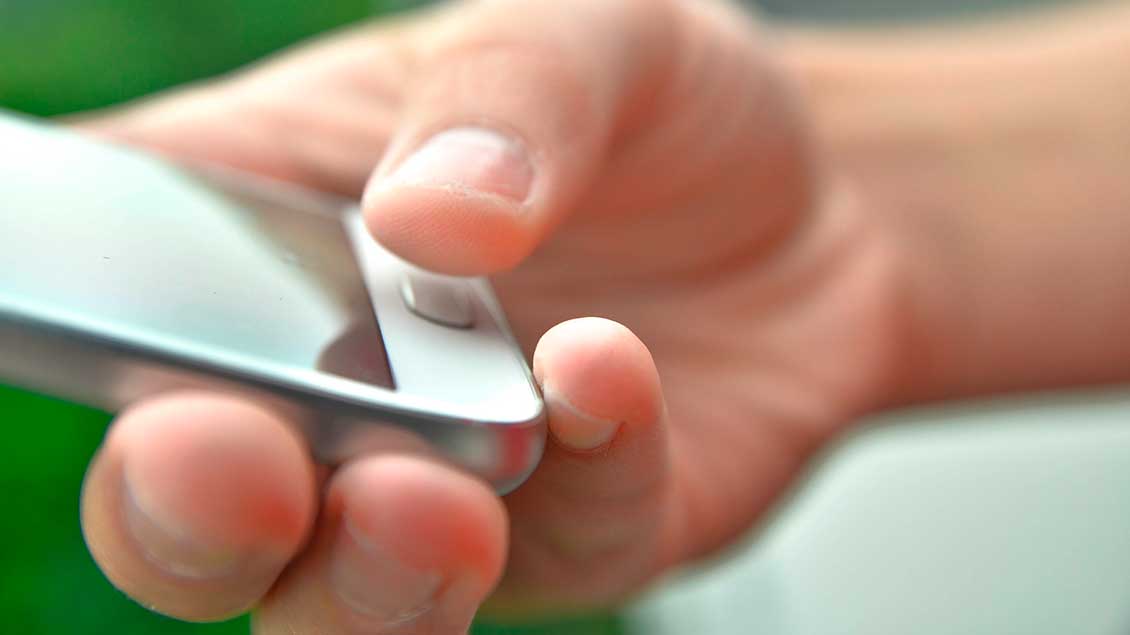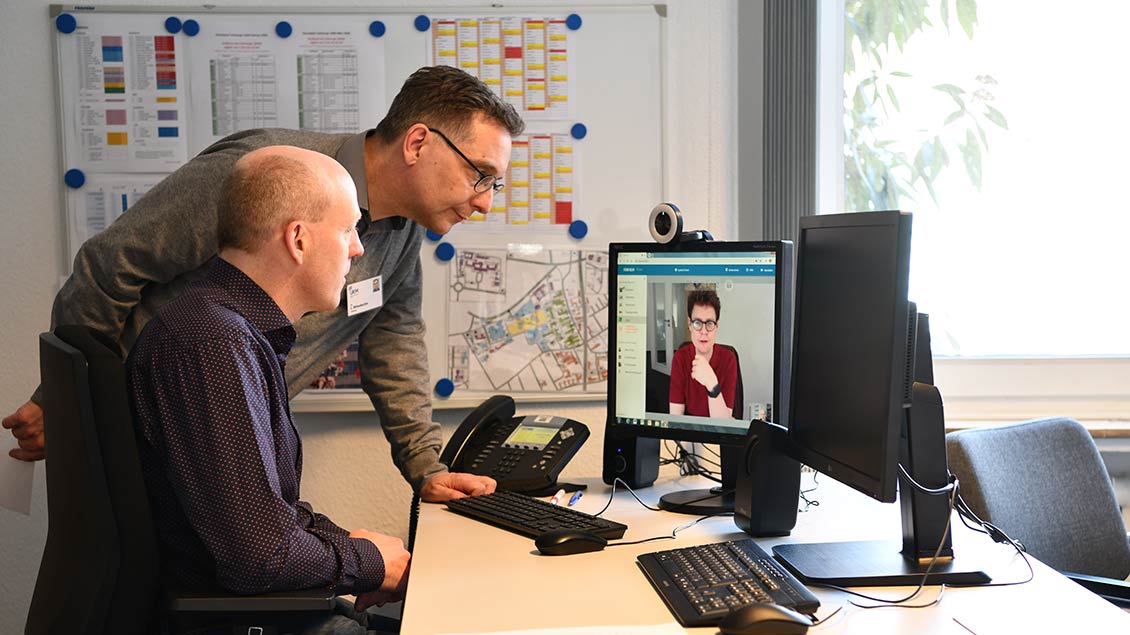Anzeige
Es gibt Momente, in denen sich alles verdichtet. In denen die Tragik, der Schmerz und die Angst für Krankenhausseelsorger mit einer Wucht spürbar werden, die auch sie nur schwer aushalten können. Wenn das Leben von Patienten nicht gerettet werden kann, wenn letzte Besuche nicht möglich sind, wenn die Corona-Pandemie ihr hässlichstes Gesicht zeigt. Es sind aber auch genau diese Augenblicke, in denen deutlich wird, dass es am Ende nicht allein um Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen gehen kann.
Krankenhausseelsorger Martin Naton aus dem Clemens-Hospital in Geldern beschreibt eine solche Situation. „Es war am Bett einer alten Dame, die im Sterben lag“, erinnert der Pastoralreferent sich an einen Besuch auf der Intensivstation während der ersten Pandemie-Welle. „Die Unsicherheit damals war noch so groß, dass Verwandte nicht zu ihr kommen durften.“ Er aber stand dort – im Schutzanzug, mit Brille und Maske. „Wie ein Astronaut.“ Viel war ihm aus der vorgegebenen Distanz nicht möglich. Wohl aber das Marienlied, das er anstimmte. „Ich bemerkte, wie sie ruhiger wurde, wie sich ihr verzweifelt kämpfender Körper entspannte.“
Situation bleibt extrem belastend
Die zweite Welle hat die Quarantäne- und Intensivstationen vieler Krankenhäuser wieder dramatisch gefüllt. Auch wenn es mittlerweile mehr Wissen über das Corona-Virus gibt, mit denen Besuchs- und Abschiedsmöglichkeiten geschaffen werden können – die Atmosphäre in den Patientenzimmer bleibt extrem belastend. Nicht allein für die Covid-19-Patienten und ihre Angehörigen, auch für die Menschen auf anderen Stationen und das medizinische und pflegende Personal.
Ulrich Lüke ist emeritierter Pfarrer und seit drei Jahren in der Krankenhausseelsorge im St.-Franziskus-Hospital in Münster im Einsatz. Für den 69-Jährige zeigt sich in der Pandemie, wie wichtig es ist, seine Arbeit als festen Bestandteil des therapeutischen Teams eines Krankenhauses zu sehen. Sonst bestünde die Gefahr, in dieser Ausnahmesituation lediglich „als Kontaminationsfaktor“ gesehen zu werden und außen vorzubleiben.
Berufsunfähig durch Angst?

Ulrich Lüke ist Krankenhausseelsorger im St.-Franziskus-Hospital in Münster.
In einer Predigt in der Hauskapelle vor einige Wochen wurde er deutlich. „Manche Seelsorger haben sich bei all dem Gerede auch nur als weitere mögliche Virusträger sehen und überflüssig machen wollen.“ Vielleicht habe auch die verständliche „Angst um das eigene Fell“ eine Rolle gespielt, sagt der promovierte Theologe und ehemalige Hochschuldozent. „Wenn ich aber aus Angst vor Ansteckung nicht mehr zu den Patienten gehen will oder kann, dann bin ich wie ein vielleicht hoch begabter Bäcker mit Mehlstauballergie – dann bin ich berufsunfähig.“
Er kennt viele Seelsorge, die das nicht sind und kann sich selbst dazu zählen, obwohl er ob seines Alters zur Risikogruppe gehört. Als sich im Frühjahr die Pandemie-Entwicklung abzeichnete, stockte er seine halbe Stelle zu einer vollen auf. Er sah das auch als ein selbstbewusstes Zeichen dafür, wie wichtig er und sein Seelsorgeteam gerade jetzt sind. „Wir haben etwas zu sagen, dass die übrigen Akteure im Krankenhaus nicht zu sagen haben.“
Mehr als nur Spachtelmasse im Krankenhaussystem
Lüke erlebte, wie dankbar der intensivierte seelsorgliche Einsatz im St.-Franziskus-Hospital aufgenommen und unterstütz wurde. „Hier hat mich keiner ausgebremst.“ Denn die Sehnsucht aller Beteiligten nach „sinndeutenden Zeichen“ sei groß. „Für viele ist es entscheidend, dass der Herrgott auch jetzt noch im Boot sitzt.“ Deshalb habe er sich nie als „Spachtelmasse“ im Krankenhaus-System fühlen müssen, sondern als tragendes Element.
Wichtig ist Lüke, dass dies nicht im „Home-Office“ geschieht. „Das wäre ungefähr so sinnvoll, wie einen geplatzten Blinddarm mit Telemedizin statt mit Chirurgie zu therapieren.“ Wie wichtig – bei Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen – die direkte Ansprache ist, hat er immer wieder erfahren dürfen. „Viele Patienten, egal ob mit Covid-19 oder mit anderen Krankheiten, schauen aufgrund der Pandemie-Einschränkungen tagelang an die Zimmerdecke“, sagt er. „Für sie kann ein Gespräch wie ein Spaziergang raus aus ihrem isolierten Einzelzimmer sein.“
Gerade jetzt ist die Zeit für den christlichen Auftrag

Hildegard Richartz-Reike ist im Gertrudis-Hospital in Herten-Westerholt im Einsatz.
Auch für Hildegard Richartz-Reike muss diese Nähe zum christlichen Selbstverständnis konfessioneller Krankenhäuser gehören. „Wir müssen gerade jetzt unseren Auftrag ernst nehmen“, sagt die Pastoralreferentin, die Seelsorgerin im Gertrudis-Hospital in Herten-Westerholt ist. Mitten in einem Pandemie-Hotspot Nordrhein-Westfalens sind dort viele Zimmer mit Covid-19-Patienten belegt. Es gab bereits Todesfälle. „Eine unheimlich belastende Situation – hier sind alle am Limit.“
Damit meint sie nicht nur die Patienten. Damit meint sie auch die Verwandten und Freunde, denen es nur in Ausnahmefällen möglich ist, ihre Lieben zu besuchen. Und sie meint damit das Personal, das sich derzeit „bis zum Rand des Ertragbaren“ einsetze. „Es liegt mir am Herzen, für alle da zu sein.“
Mit Mund-Nasen-Schutz in der Sitzecke
Die ehemalige Krankenschwester hat dabei sicher ein besonderes Gefühl für die Mitarbeiter, vom Intensivpfleger bis hin zum Küchenhelfer. Alle sind in ihren Augen mehrfach belastet: „Neben der angespannten Situation im Beruf und möglichen Ängsten um die eigene Gesundheit wartet daheim auch auf sie der Stress des Corona-Lebens.“ Die 57-Jährige erlebt immer wieder, wie wichtig ihre Präsenz auf den Krankenhausfluren ist. „Mit dem Mund-Nasen-Schutz Ansprechpartner in der Sitzecke zu sein, bedeutet schon viel – da hat mir schon mancher sein Herz ausgeschüttet.“
Sie setzt zusätzlich mutmachende Zeichen. Die Kapelle hält sie für die Mitarbeiter Tag und Nacht offen. Es läuft Musik – Momente der Ruhe, eine Auszeit im funktionsgesteuerten Krankenhausalltag ist möglich. Zudem hat sie kleine Karten mit Gebeten und Sinnsprüchen bedruckt. Im Ausweisformat, damit sie in die Kitteltasche passen, und einlaminiert, damit sie desinfiziert werde können. Und sie hat kleine Schutzengel als Schlüsselanhänger gebastelt. Wenn sie über die Stationen geht, winken die Mitarbeiter ihr damit aus der Entfernung zu – ein Zeichen der Dankbarkeit unter Einhaltung der Abstandsregeln.
Die Zeit ist entscheidend

Gabriele Ibing aus der Paracelsus-Klinik in Marl.
Diesen Dank erfährt sie auch bei ihren Besuchen in den Patientenzimmern, die sie in den vergangenen Wochen noch einmal intensiviert hat. Sie spürt das trotz Abstand und voller Schutzausrüstung. „Was zählt ist die Zeit, die ich mitbringe.“ Es kommt jemand, der keine Spritze setzen oder einen Verband überprüfen muss, sondern einer, der „einfach nur da ist“. Ihre Augen und ihre Stimme sind das, was jetzt gefragt ist, sagt Richartz-Reike. „Die sind die gleichen wie früher.“
Immer wieder hat sie neue Ideen, wie sie in diesen Zeiten Normalität und Ablenkung in die Krankenzimmer bringen kann. Bald soll Musik aus der tragbaren Box dabei helfen, kleine besinnliche Zeiten mit Texten und Gesang anzubieten. „Wenn das Gotteslob dann im Anschluss nicht mehr desinfiziert werden kann, entsorgen wir es halt – es gibt Wichtigeres.“
Blumen vor den Umkleidekabinen
Gabriele Ibing aus der Paracelsus-Klinik in Marl hat ebenfalls alle Menschen im Hospital in den Blick genommen. Für die Mitarbeiter stellte die Pastoralreferentin und Krankenhausseelsorgerin Eimer mit Blumen zum Mitnehmen vor die Umkleideräume. Im Advent verteilt sie an die „zunehmend erschöpften Pfleger von Covid-19-Patienten“ Tüten mit Schokolade und besinnlichen Texten.
Der Kontakt zu den Patienten läuft noch viel über das Telefon, auch wenn der Zugang zu den Krankenzimmern mittlerweile leichter zu organisieren ist als noch im Frühjahr. „Gerade aber die alten, schwerstkranken und dementen Patienten sind oft kaum noch in der Lage, von sich aus Kontakt aufzunehmen.“ Die 62-Jährige ist deshalb auch vermehrt als Botin unterwegs. „Am Telefon oder vor dem Krankenhaus sind Angehörige mit Fragen oder Wünschen.“ Die überbringt sie ins Krankenzimmer und kommt mit Antworten zurück.
Kirche kneift nicht

Martin Naton erlebt intensive Momente im Clemens-Hospital in Geldern.
„Wir wollen zeigen, dass Kirche in dieser Situation nicht kneift“, sagt sie. Viele Möglichkeiten der Begegnung, besonders gemeinsame Gottesdienst oder Gruppenangebote, fallen derzeit weg. „Das ist aber kein Grund, von der Bildfläche zu verschwinden.“ Im Gegenteil – Kirche betritt die Bildfläche, aber anders: Ein Bereich in der Kapelle wurde abgetrennt, um dort ambulante Patienten separat empfangen zu können. „Der liebe Gott hat da sicher kein Problem mit.“
In Pandemiezeiten ist Kreativität gefragt. Auch im Clemens-Hospital in Geldern, wo Martin Naton versucht, die vielen ehrenamtlichen Helfer wieder einzubinden, denen derzeit der Zutritt zu den Stationen verwehrt bleibt. Er plant einen Telefon-Bereitschaftsdienst, mit dem Patienten rund um die Uhr Kontakt aufnehmen können. Für den direkten Besuch gibt es derzeit nur die kleine Gruppe hauptamtlicher Seelsorger.
Auch den Seelsorgern fehlt die Nähe
Er selbst denkt dabei immer wieder an jenen Moment am Bett der sterbenden Dame. „Das wichtigste Element meiner Arbeit ist eigentlich die Nähe, oft auch die Berührung, das Halten der Hand.“ Im Augenblick aber steht er dort als „Astronaut“ in einigen Metern Entfernung. „Was muss das für Gefühle in einem Menschen auslösen, bei dem es um Leben und Tod geht.“ Er hat erfahren, dass es in dieser Situation andere Wege gibt, das Herz und die Seele des Menschen zu erreichen. Bei der alten Frau war es das Lied. „Bei anderen ein Gebet oder Grüße, die ich übermittele.“
Naton selbst hat sich vorgenommen, einen Tag durch das Krankenhaus zu gehen, wenn die Pandemie keine Bedrohung mehr darstellt. „Ich werde jeden umarmen – genau das ist es, was auch mir im Augenblick am meisten fehlt.“