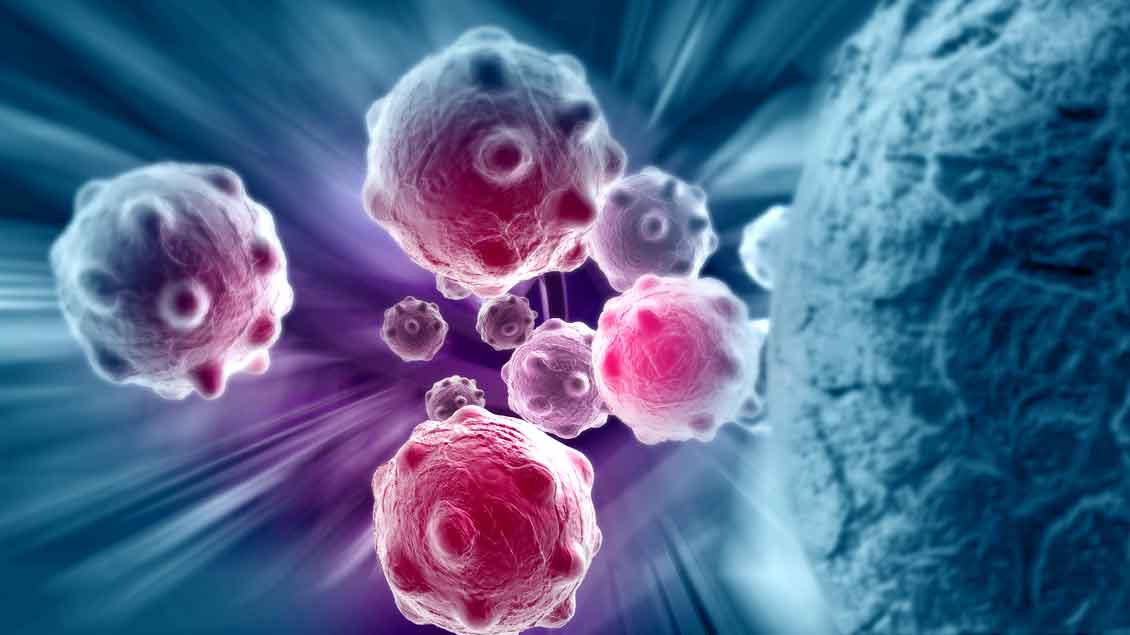Anzeige
Den Leuten heute geht es viel zu gut. Wenn sie erst einmal ernsthaft krank sind, eine persönliche Katastrophe erleben oder an Leib und Leben bedroht sind, lernen sie schon wieder zu beten und in den Gottesdienst zu kommen. „Schwarze Pädagogik“ nennt Professor Gereon Heuft solche Thesen. Von ihnen war angesichts sich leerender Gotteshäuser bis vor wenigen Jahrzehnten so mancher Kirchenvertreter überzeugt.
Der Ärztliche Direktor der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie am Uniklinikum Münster hat täglich mit Menschen in Not zu tun: Krebs-, Unfall- und Transplantations-Patienten, die körperlich und seelisch leiden. Menschen mit Suchtproblemen, Essstörungen, Depressionen, Traumata. Gereon Heuft fiel bei seinen Gesprächen am Krankenbett auf, dass immer mehr Patienten es „unerträglich finden, auf Unterstützung angewiesen zu sein“.
Wunsch nach Sterbehilfe
Über die Hälfte der bundesdeutschen Bevölkerung sei inzwischen der Meinung, dass aktive Sterbehilfe durch den Arzt akzeptabel ist. Den Satz „Wenn ich hilfebedürftig werde, fahre ich in die Schweiz zur Sterbehilfe“ habe er vor zehn Jahren nicht gehört. Er fragte sich folglich: Woran glauben heutige Menschen, wenn sie in Not geraten? Kommen sie in oder durch ihr Leiden dazu, sich an Gott zu wenden, ihn zu suchen, zu meditieren, den Gottesdienst zu feiern? Lehrt Not beten?
 Diakon, Arzt und Klinkleiter in Münster: Gereon Heuft. | Foto: Privat
Diakon, Arzt und Klinkleiter in Münster: Gereon Heuft. | Foto: Privat
Gereon Heuft ist nicht nur Arzt, Klinikleiter und Lehrstuhlinhaber. 2008 wurde er zum Diakon im Zivilberuf geweiht. Im selben Jahr nahm er – „als Hobby in der Freizeit“ – ein Theologiestudium auf, dass er mit dem Diplom und der 2016 im münsterschen Aschendorff-Verlag erschienenen Doktorarbeit abschloss. „Not lehrt (nicht) beten“ lautet ihr Titel. Sie basiert auf einer 2013 von ihm durchgeführten Erhebung und Analyse von Daten.
Katholisch heißt nicht automatisch gläubig
Der Klinikleiter legte allen Patienten seiner psychosomatischen und psychotherapeutischen Ambulanz einen von ihm entwickelten, zwölf Komplexe (Items) umfassenden Fragebogen vor und stellte die Ergebnisse in Beziehung zu einer bundesweiten, allgemeinen Umfrage von 2500 Menschen im selben Jahr zum Thema Religion.
Schon die allgemeinen Daten lieferten Überraschendes: Die Zugehörigkeit zu einer Konfession sagt nur bedingt etwas über den Glauben der Menschen aus. „Lediglich 17 Prozent der evangelischen und 26 Prozent der katholischen Christen beschreiben sich selbst als gläubig“, schreibt Heuft.
Fünf Religions-Typen
„Eher gläubig“ sehen sich 45 Prozent der Evangelischen und zwei Drittel der Katholischen. Im Vergleich: 75 Prozent der Muslime verstehen sich als „eher gläubig“. „Eher ungläubig“ sind nach eigener Einschätzung immerhin 31 Prozent der Evangelischen und 22 Prozent der Katholiken. Auch das auf die Not-Frage ausgerichtete Ergebnis der repräsentativen Untersuchung lässt sich klar zusammenfassen: Not lehrt nicht beten. Bestenfalls lehrt Not, nach Gott oder nach dem Sinn des Lebens zu suchen. Jedoch nicht automatisch und notgedrungen, sondern – wenn überhaupt – in Beziehung und abhängig von der vorhandenen religiösen Einstellung des Einzelnen.
Heuft hat fünf Religions-Typen herausgearbeitet, zwischen denen er die Grenzen nicht zu scharf ziehen will: 1. die Verweigerer des religiösen Gesprächs. 20 Prozent der Patienten lehnte es ab, den Religions-Fragebogen zu beantworten. Das bedeute aber nicht, dass diese Gruppe areligiös sei. 2. die offen religiös Ungebundenen, 3. die religiös Sehnsüchtigen, aber eher Praxisfernen, 4. die religiös Disponierten (Verfassten), aber Praxisfernen und 5. die religiös Verankerten und Praktizierenden.
Gefühle und Glauben
Letztere findet man etwa als Engagierte in Pfarrgemeinden. Doch auch sie sind in der Lebenskrise nicht vor Glaubenskonflikten gefeit. So berichtet der Arzt von einer Patientin, die plötzlich auf den Rollstuhl angewiesen war und haderte, warum Gott sie bestraft. Sie habe sich doch nichts zu Schulden kommen lassen und immerzu für andere gesorgt.
Zudem stellte er fest, dass gerade Menschen, deren psychische Struktur wenig stabil ist, sich schwer mit dem Glauben tun. Das sieht er als „Tragik“, denn diese Gruppe könne durch die Beziehung zu einem guten Gott Kraft und Orientierung gewinnen. Unter „psychischer Struktur“ versteht man das „Funktionsniveau der Psyche“: „Wie ich mich selbst und meine Gefühle steuern kann, etwa in Stresssituation. Wie ich die Beziehung zu anderen und zu mir selbst verstehe und gestalte. Bin ich aggressiv, wende ich die Aggression gegen mich selbst, kann ich Beziehungen aufbauen und halten?“
Nicht gern abhängig
An wen wenden sich aber Menschen, wenn sie in schweren Lebenskrisen nicht auf den Gedanken kommen, Gott und sein Heilsversprechen für sich in Anspruch zu nehmen? Verlassen sie sich auf Partner, Kinder, Freunde, das soziale Netz aus Ärzten, Pflegern, Psychologen, Hospizen?
Vereinfacht ausgedrückt, sucht eine Mehrheit das Heil in sich selbst. Heuft spricht von „Selbstoptimierern“, die allein darauf vertrauen, was sie selbst gemacht haben: durch Beruf, Bildung, Karriere, Kinder, Leistungen jeglicher Art. „Das Gefühl, als Mensch grundsätzlich in Abhängigkeit zu stehen, da ich mich auch nicht selber gemacht habe, wird immer weniger wahrgenommen. Statt dessen versuche ich, alles selber in der Hand zu halten.“
Religion als Marktwirtschaft
Diese Tendenz habe gesellschaftliche Auswirkungen: Eltern, die persönlich beleidigt sind, wenn das Kind in der Schule Schwierigkeiten hat. „Massive Empathie-Störungen“, von Gaffern, die Videos an der Unfallstelle drehen, statt die Helfer zu den Verletzten durchzulassen. Heuft zieht Konsequenzen: Katholischsein bedeute nicht mehr eine klare, einheitliche, gar amtskirchliche Einstellung. „Jeder normative Zugang in der Pastoral verbietet sich“, sagt er. Seelsorger, Priester, Diakone, Pastoralreferenten müssten „heute mehr denn je auf den Einzelnen schauen.“
Kritisch sieht Heuft auch die vom Bistum Münster in Auftrag gegebene Zufriedenheitsstudie aus dem Jahr 2015, erstellt unter der Regie der Marketing- und Wirtschaftsexperten Heribert Meffert und Peter Kenning. Ihr Plädoyer sei, „dass die Kirche verschiedene Angebote machen und den Service verbessern muss, um am Markt bestehen zu bleiben“.
Service schafft keine Bindung
„Aus Service erwächst keine Verbindung, sondern nur eine kurzfristige Befriedigung.“ Mit „theologischem Junkfood“ könne man die Krise nicht bewältigen, warnt er. Sondern nur mit „der Botschaft des Evangeliums und persönlicher Zeugenschaft und Identität“. – „Ich sage das aus einer Sorge heraus“, betont Heuft. Schon heute leide die Mehrheit der Seelsorger darunter, dass ihre Angebote nicht angenommen würden. „Unter dem Gesetz des Marktes läuft das auf eine Insolvenz hinaus.“ Es brauche nicht Seelsorger, die stolz auf ihre Leistungen sind, sondern Engagierte, die nicht ausgrenzen und bereit sind, mit den Menschen gemeinsam um das Evangelium zu ringen.