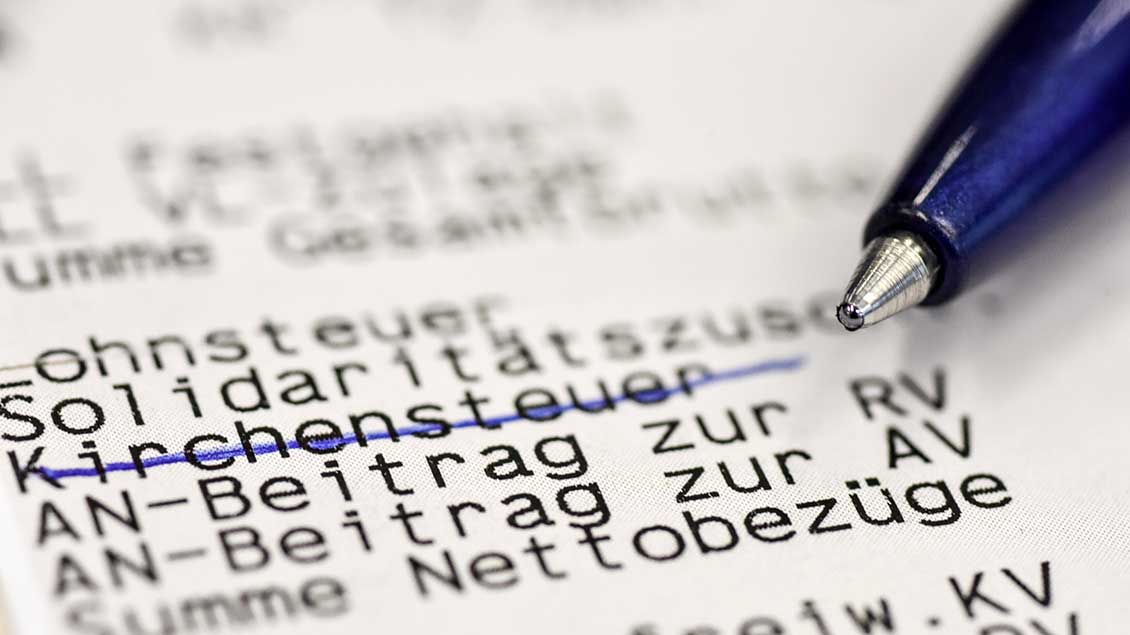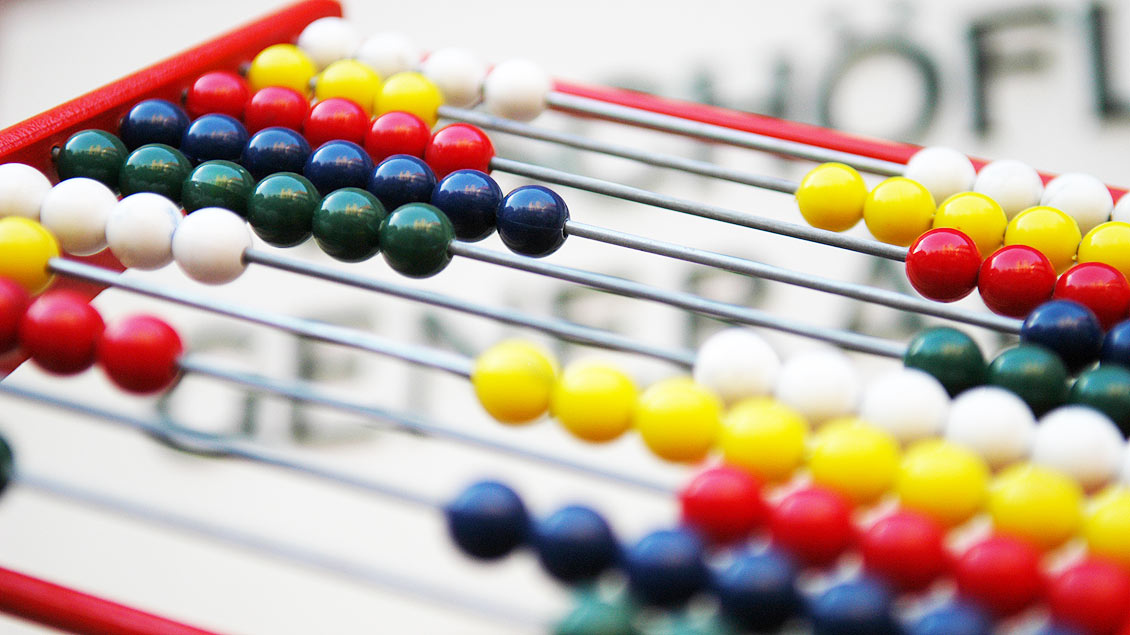Anzeige
Der Kirche schwinden die Mitglieder - und damit auch die Finanzen. Drehen an vorhandenen Stellschrauben ist wichtig, um zukunftsfähig zu werden, sagt Expertin Anna Ott - aber ohne eines ist alles andere nichts.
Eine Überwindung der kirchlichen Vertrauenskrise steht für die Kirchenrechtlerin Anna Ott vor allen Finanzreformen. „Wenn die Kirche ihre Finanzierung sicherstellen will, braucht sie Gläubige, die sich mit ihr identifizieren“, sagt die Leiterin der Stabsstelle Kirchenrecht im Bischöflichen Ordinariat Mainz im Interview des Portals katholisch.de (Dienstag). Das gelte für alle denkbaren Modelle: „Für die Kirchensteuer, damit die Leute nicht austreten. Für die Kultursteuer, damit die Leute ihr Kreuzchen bei der Steuererklärung bei der Kirche machen. Für Fundraising, damit die Leute für kirchliche Zwecke spenden.“
Grundsätzlich habe die Kirche noch rund zehn Jahre zum Umsteuern. Wenn die sogenannten Babyboomer, die geburtenstarken Jahrgänge bis 1969, als derzeit stärkste Zahler in den Ruhestand gehen, fehle nach jetzigen Maßstäben definitiv Geld in der Kasse, um den Bedarf zu decken. Allerdings, so Ott, sei die Befassung mit einem langfristigen und komplizierten Thema wie der Kirchenfinanzierung angesichts akuter Krisen in Kirche und Politik eine große Herausforderung.
Systemwechsel „nur in rechtlich leerem Raum” denkbar
Auch sei ein kompletter Systemwechsel weg vom deutschen Kirchensteuersystem nur in einem rechtlich leeren Raum zu entwerfen, gibt die Expertin zu bedenken. So wäre eine Kultursteuer wie in Italien wohl „weniger konfliktträchtig und besser akzeptiert“ als eine Kirchensteuer. „Aber wir sind nicht im leeren Raum“, sagt Ott. Eine „Kultursteuer als Alternative zur Kirchensteuer müsste rechtlich ermöglicht und politisch vertreten werden - das halte ich für ausgeschlossen.“
Neben der Förderung von Fundraising, wo „zielgerichtete Spenden für konkrete Projekte die Identifikation mit einer guten Sache erhöhen“, sieht die Mainzer Bistumsverantwortliche auch bei der Kirchensteuer selbst weitere Stellschrauben, „an denen man drehen könnte, ohne gleich ans Grundgesetz zu müssen“.
Kirche könnte Basis stärker einbeziehen
Ott nennt etwa mehr Mitbestimmung der zahlenden Gläubigen. „Wie die Kirche ihre Einnahmen aus der Kirchensteuer verwaltet, ist ihr komplett selbst überlassen. Sie könnte also auch die Basis stärker darin einbeziehen, wofür das Geld verwendet wird.“ Zwar müsse im Kirchenrecht die Letztverantwortung immer in der Hand des Pfarrers bzw. des Bischofs liegen; „aber beim Maß der Beteiligung gibt es viel Spielraum“, so Ott.
Mit Blick auf den Vorschlag, die Kirchensteuer wie in der Schweiz nicht den Bistümern, sondern den Pfarreien zukommen zu lassen, plädiert die Kirchenrechtlerin eher für ein kombiniertes System. „Eine finanzielle Stärkung der Basis statt der übergeordneten Strukturen“ wäre zwar zu begrüßen, auch hinsichtlich der Akzeptanz.
Ausgleichszahlungen zwischen armen und reichen Pfarreien
Es bräuchte aber auch Systeme von Ausgleichszahlungen zwischen armen und reichen Pfarreien sowie Gelder für übergeordnete Aufgaben. Das jetzige deutsche System mit sehr großen Bistumsverwaltungen „sorgt für eine Macht- und Kompetenzkonzentration auf Ebene der Diözese“ - über die zentrale Stellung hinaus, die der Bischof nach dem Kirchenrecht ohnehin schon habe.
Jenseits aller rechtlichen Probleme bei der Umsetzung dürfe die Kirche diese Frage auf keinen Fall aussitzen, mahnt Ott. Derzeit gebe es noch Handlungsspielräume. Kirche müsse also ihre Kernbereiche definieren, „die sie erhalten und finanzieren muss, um weiterhin Kirche zu sein“. Eine Priorisierung kirchlicher Aufgaben sei schmerzhaft, „weil Einsparen immer weh tut; und es braucht dazu viel Kommunikation und Beteiligung, damit es akzeptiert wird“. Zudem müsse man weg von der derzeitigen „Ein-Säulen-Finanzierung“ und sich breiter aufstellen. „Aber vor allem muss die Kirche ihr Vertrauensproblem in den Griff bekommen.“