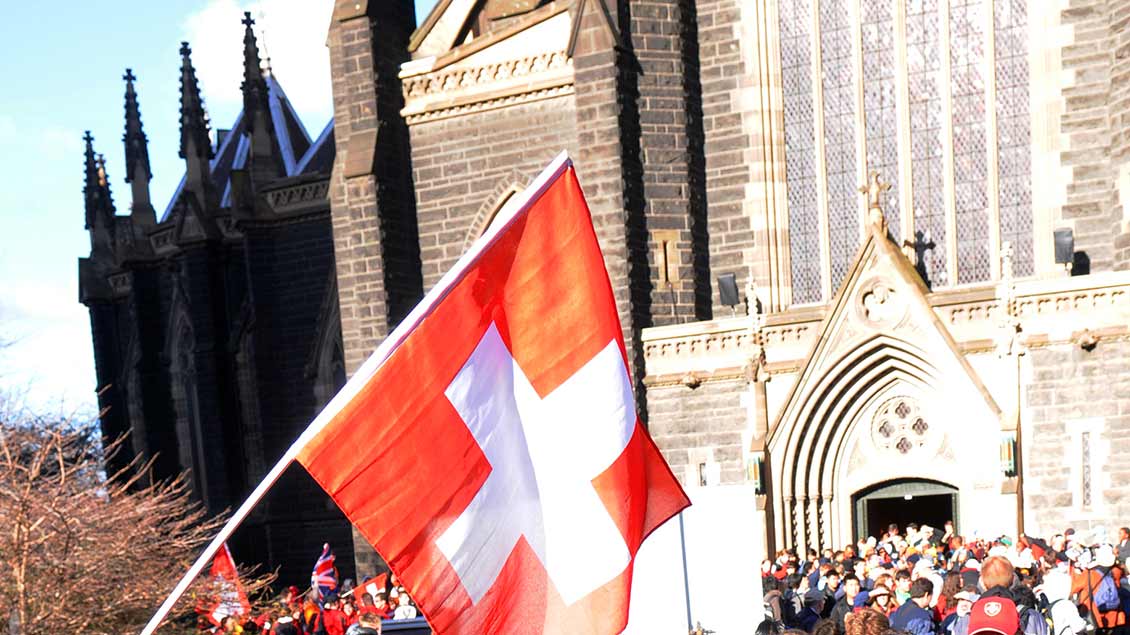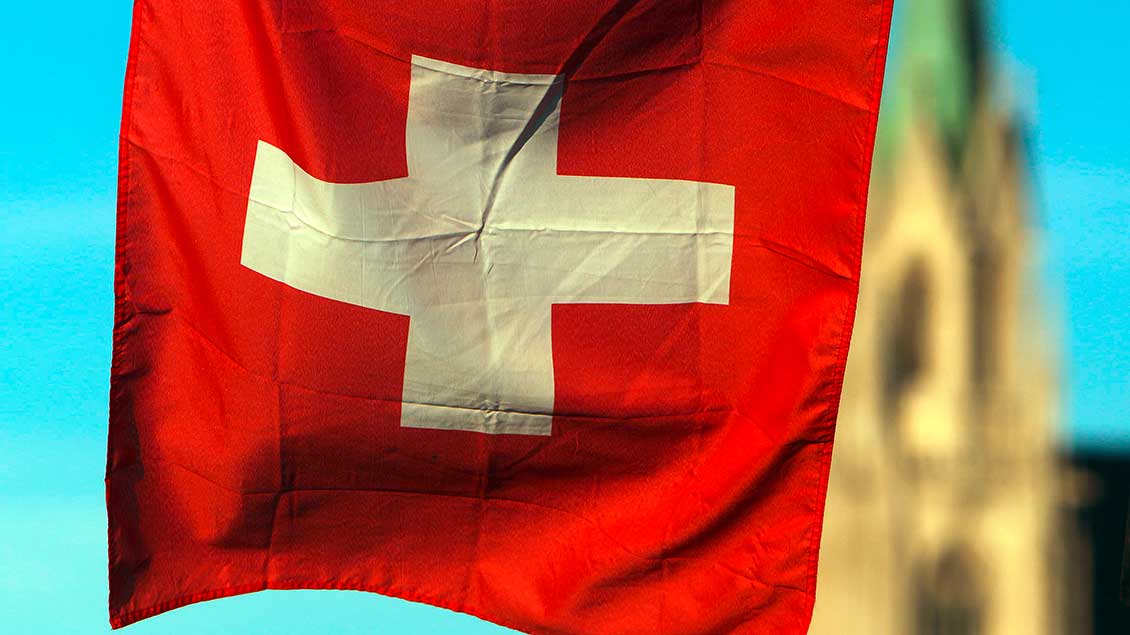Anzeige
Ein Forscherteam der Uni Zürich hat 1.002 Fälle sexuellen Missbrauchs aufgedeckt. Bis um das Jahr 2000 wurde systematisch vertuscht, kaum ein Fall nach Rom gemeldet. Doch der Druck von Betroffenen und Medien zwang nun zum Handeln.
Die gute Nachricht zuerst: Die Forschenden der Uni Zürich hatten vollen Zugang zu den Bistumsarchiven. Und die Akten zeigen: Von der Mitte des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart war klerikaler Missbrauch auch in der Schweiz endemisch. Diese Erkenntnis ist wenig überraschend - doch deshalb nicht weniger erschütternd. 1.002 Fälle, 510 Beschuldigte und 921 Betroffene: Laut Historiker Lucas Federer dürften diese Zahlen "nur die Spitze des Eisbergs sein". Denn die Arbeit des Teams hat erst begonnen. Eine abschließende Studie soll in drei Jahren vorliegen.
Schon jetzt ist klar: Die Schweiz ist kein Sonderfall. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache, auch was die Altersstruktur der Betroffenen angeht. 74 Prozent der identifizierten Fälle betrafen sexuellen Missbrauch von Minderjährigen - "von Säuglingen und vorpubertären Kindern bis hin zu postpubertären jungen Erwachsenen". Und die Zahlen werden noch steigen. Dokumente aus katholischen Fürsorgeinstitutionen wie Heimen und Schulen konnten noch nicht berücksichtigt werden. Auch Ordensgemeinschaften und Neue geistliche Gemeinschaften und Bewegungen haben ihre Archive bislang nur sehr begrenzt zugänglich gemacht.
Verurteilt wegen "Vielzahl an Übergriffen auf Buben"
Doch bereits die Vorstudie zeigt, was die Hauptstudie künftig breiter untermauern dürfte. Im Untersuchungszeitraum, der sich von den 1950er Jahren bis in die Gegenwart erstreckt, herrschte eine Kultur des Wegschauens. Anhand von Fallbeispielen zeigen die Forschenden, dass Bistümer ihre Priester selbst dann schützten, wenn die schon von weltlichen Gerichten verurteilt wurden.
Beispiel K.M.: Der Priester wurde 1989 von einem Bündner Gericht wegen einer "Vielzahl an Übergriffen auf Buben" verurteilt. Berufliche Folgen hatte das Urteil für ihn nicht. K. M. durfte weiter mit Jugendlichen arbeiten. Ein kirchliches Verfahren wurde nie eröffnet, obwohl die interne Kommunikation des Bistums zeigt, dass man sich der Probleme und Risiken bewusst war.
Systematische Kirchenrechtsverstöße
Im Untersuchungszeitraum wurden kirchenrechtliche Strafverfahren systematisch vermieden. Die Geisteshaltung dahinter zeigt sich im Brief eines Basler Domherren, der 1968 an einen Beschuldigten schrieb: "Der Fall müsste nach Kirchenrecht nach Rom berichtet werden. Wir tun das gewöhnlich nicht, damit die Priester nach Verbüßung der Strafe leichter wieder irgendwo verwendet werden können."
Diese Haltung änderte sich auch in späteren Jahrzehnten nicht. Der Sankt Galler Bischof Otmar Mäder (1976-1994) nutzte in den 80er Jahren die Androhung eines kirchenrechtlichen Prozesses als Disziplinierungsmaßnahme. Das Forschungsteam fand aber keine Belege, dass auf die Drohung je Taten folgten.
Zahnlose Gremien
Das Kirchenrecht verpflichtet den Ortsbischof seit 1917 zu einer kirchenstrafrechtlichen Untersuchung und Ahndung eines jeden Missbrauchsfalls. Wie Amtsbrüder weltweit haben Schweizer Bischöfe das Kirchenrecht also wissentlich ignoriert. Auch hier haben Bischöfe die Täter geschützt. Eine unbedingte Meldepflicht nach Rom verhängte der Vatikan erst 2001.
Dies änderte aber in der Schweiz noch wenig. Zwar kam es in den 2000er Jahren zur Gründung von Fachgremien auf Bistumsebene, an die sich Missbrauchsbetroffene wenden konnten. Doch das Forschungsteam zeigt, dass diese Gremien zahnlos blieben. Erst der seit 2010 stetig wachsende Druck der Öffentlichkeit führte zu vermehrter Anwendung des kirchlichen Strafrechts. Ohne den Druck von Betroffenenorganisationen und Medien hätte sich am Agieren der Kirchenoberen wohl bis heute nichts geändert. Auch das ist eine Erkenntnis der Vorstudie.
Auch Gemeinden schützten Täter
Eine weitere: Nicht nur Bischöfe, sondern auch Gemeinden schützten Täter. In einer Walliser Gemeinde sagten in den 70er Jahren 27 Kinder gegen den Pfarrer R.G. aus, der die Taten auch gestand. Trotzdem waren nur zwei Mütter bereit, sich öffentlich zu exponieren und als Nebenklägerinnen aufzutreten.
Ein Betroffener berichtet, es sei in der Folge zu Konflikten im Dorf gekommen. Mütter wie Kinder seien von Pfarreimitgliedern unter Druck gesetzt worden, ihre Anklage zurückzuziehen. Noch in den 70er Jahren war der Pfarrer als "Vertreter Gottes" für viele selbst bei schweren Vergehen unantastbar.
Aktenvernichtung überall - fast
Neben strukturellen Fragen legt die Vorstudie großes Augenmerk auf die Aktenbestände. Die Lage in den Bistumsarchiven unterscheidet sich beträchtlich. In Basel, Chur, Sitten und Sankt Gallen fanden die Forschenden professionelle Archive vor. In Lausanne-Genf-Fribourg und Lugano war die Situation hingegen unübersichtlich.
Fast alle Bistümer - mit Ausnahme Basels - haben Akten vernichtet. Größtenteils taten sie dies in Einklang mit dem Kirchenrecht. Das verlangt, Personalakten von Priestern, denen "Strafsachen in Sittlichkeitsverfahren" vorgeworfen werden, nach zehn Jahren zu zerstören. Allerdings sind Bistümer verpflichtet, vorher eine schriftliche Zusammenfassung der Vorwürfe anzufertigen und diese aufzubewahren. Die Forschenden halten fest, dass solche Zusammenfassungen nicht überall aufgehoben wurden. Besonders die Lücken in Sankt Gallen, Lausanne-Genf-Fribourg und Chur werfen Fragen auf.
Um kirchlichen Missbrauch aufarbeiten zu können, sind Personalakten mutmaßlicher Täter unabdingbar; im Idealfall die kompletten Dossiers, mindestens aber inhaltliche Zusammenfassungen. Die Vorstudie schließt daher mit der dringenden Empfehlung, "dass zukünftig innerhalb der kirchlichen Institutionen keine thematisch relevanten Dokumente mehr vernichtet werden".