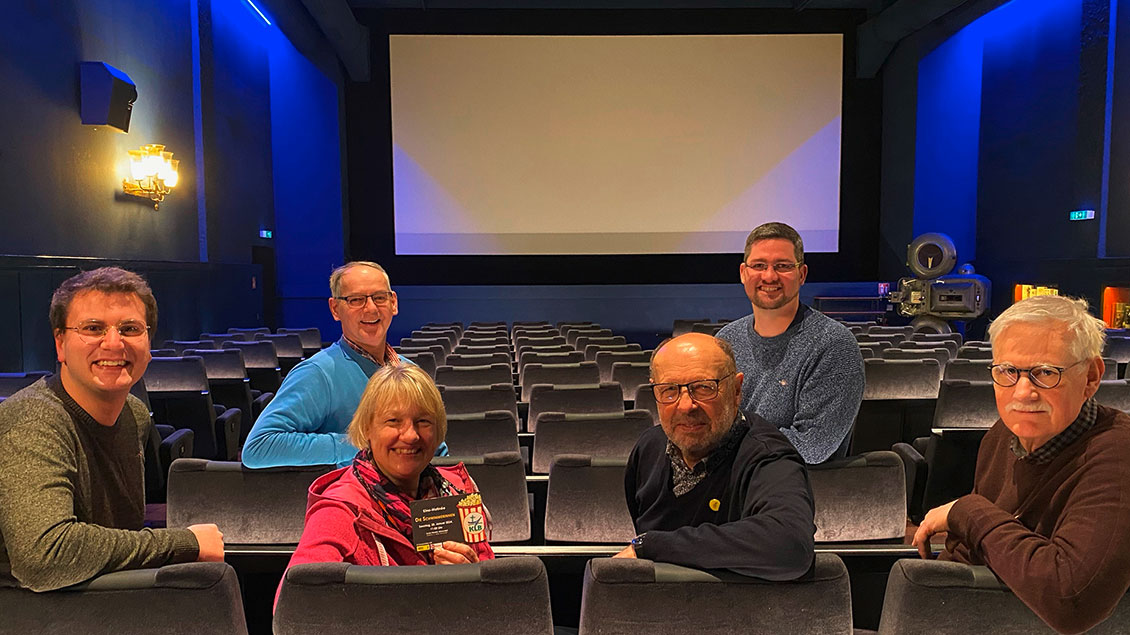Anzeige
Bevor Claudia Löchelt und Andreas Feindt aus Münster in ihrem Haus Flüchtlinge aus der Ukraine aufnahmen, tagte der Familienrat. Denn der Alltag mit ihren zwei Kindern musste weitergehen.
Svitlana Demkovych hat Kuchen mitgebracht. „Käsekuchen – typisch ukrainisch“, sagt sie. „Wir essen ihn mit Honig.“ Mit Claudia Löchent und Andreas Feindt hat sie an deren Küchentisch im Reihenhaus in Münster-Gievenbeck Platz genommen. Etwas später kommt auch Lena Medvedova dazu. Zusammen sitzen sie an einem entscheidenden Ort einer langen gemeinsamen Zeit.
Mehr als zehn Monate waren die Ukrainerinnen mit ihren beiden Söhnen Gast im Haus. Und der Küchentisch war das Zentrum des Zusammenfindens. „Hier haben wir gesessen und verstehen gelernt“, sagt Feindt. Das ist ihm wichtig: „Es entwickelte sich auf beiden Seiten ein Verständnis – sensibel und emphatisch.“ Die Integration der Flüchtlinge in das Familienleben war keine einseitige Entwicklung. „Beide Seiten haben viel erleben und Neues erfahren können.“
Aufnahme der Ukraine-Flüchtlinge kein Schnellschuss
Als die Anfrage aus dem Bekanntenkreis kam, ob die Familie Platz für die Flüchtlinge hat, war die Entscheidung kein Schnellschuss. „Wir haben im Familienrat intensiv diskutiert, ob und wie wir uns das vorstellen können“, sagt Löchelt. „Wir“, das sind die Eltern und die beiden jugendlichen Kinder. Platz war da, die Zimmer der zwei anderen, bereits ausgezogenen Kinder standen zur Verfügung. „Es ging aber auch darum, ob wir uns das Zusammenleben mit den Flüchtlingen im Alltag vorstellen konnten.“
Konnten sie. Wenig später standen die Frauen mit ihren Kindern vor der Tür. Keiner wusste genau, wer da kam, mit welchen Erlebnissen und Vorstellungen im Gepäck. „Da war viel Offenheit wichtig“, sagt Löchelt. „Wir wussten ja auch nicht, wie wir selbst auf die Situation reagieren würden.“ Das Gleiche galt für die Ukrainerinnen. „Wir waren fremd, in einem fremden Haus, mit fremden Menschen“, sagt Demkovych.
Zusammenleben musste sich einspielen
Was sich schnell ändern sollte. Vor allem am Küchentisch, wo zentrale Berührungspunkte entstanden. „Wir hatten das Gefühl, dass wir wie eigene Kinder willkommen waren“, sagt Demkovych. Wenn sie das sagt, steigen nicht nur ihr die Tränen in die Augen. Auch die Hebamme und der Erziehungswissenschaftler sind deutlich gerührt, wenn sie von der großen Dankbarkeit für ihre Gastfreundschaft hören.
Das Zusammenleben musste sich aber auch erst einrenken. „Das Essen“, nennt Löchelt ein Beispiel. Natürlich war es spannend, als die deutsche Familie das erste Mal die traditionelle Rote-Beete-Suppe Borschtsch probieren konnte. Die Ukrainerinnen kosteten erstmals eine deutsche Linsensuppe. „Wir mussten aber auch einen Rhythmus und eine Form bei den Mahlzeiten finden, der zu unseren unterschiedlichen Situationen passte.“ Es wurden Zeiten eingerichtet, in denen die Küche genutzt werden konnte – auch ohne immer gemeinsam am Tisch zu sitzen.
Familienleben behielt eigenen Raum
„Denn bei aller Öffnung war es wichtig, sich nicht in der Situation zu verlieren, das Leben der Familie völlig unterzuordnen“, sagt Feindt. Die neue Nähe brauchte auch Distanz. Das bemerkte er etwa bei den Fahrradtouren, zu denen er den Sohn von Demkovych mitnahm. „Ich fühlte, dass da eine Erwartung wuchs, die mir etwas zu intensiv wurde.“ Solche Situationen konnten gelöst werden, weil die Ukrainerinnen sensibel darauf eingingen.
Sensibilität spielte eine zentrale Rolle. Denn es trafen immer noch Welten aufeinander: Hier die Menschen im normalen deutschen Alltagsrhythmus, dort die Frauen, die im Schrecken des Kriegs ihre Eltern und Männer zurücklassen mussten. „Wir haben hier in Gievenbeck die Luftangriffe in ihrer Heimat mitverfolgen können“, sagt Feindt. „Bei jeder Alarmmeldung dort, pingten auch hier die Handys von Svitlana und Lena.“
Beide Seiten lernen voneinander
Für Demkovych war der Umgang mit den Kindern in Deutschland ein Schlüsselerlebnis. „Die Väter spielen oft mit ihnen – das kennen wir daheim kaum.“ Auch bei diesem Thema ist zu merken, dass beide Seiten Neues gelernt haben. „Wenn ich höre, wie viel und wie hart die Männer in der Ukraine arbeiten müssen, ist das absolut nachvollziehbar“, sagt Löchelt.
Bei allem Lernen, Hintergründigen und auch Belastenden – leichte Momente gab es viele. Madvdora Olena backte als gelernte Konditorin bunte Torten. Der Freitagabend war oft für gemeinsames Pizza-Essen und Fernseh-Gucken reserviert. Und es wurde auch mal mit den Freunden der Familie die ganze Nacht durchgefeiert. „Das war wichtig“, sagt Demkovych. „Um die Schwere hinter sich lassen zu können.“
Ukrainerinnen ziehen in eigene Wohnung
Die Ukrainerin sagt in diesem Augenblick einen Satz, der zunächst schwer zu verdauen ist. „Wir waren hier oft richtig glücklich.“ Eben so glücklich, wie Flüchtlinge fern der Heimat sein können: „Aufgenommen und aufgefangen.“ Dazu gehörte auch, die Zukunft gemeinsam in den Blick zu nehmen.
Der Auszug nach einiger Zeit in eigene Wohnungen war von Beginn an eingeplant. Vor dem Gespräch darüber mit ihren Gästen hatten die Gastgeber durchaus Respekt. Aber auch hier spürten sie von ihnen genau das, was die Situation in dem Reihenhaus die ganze Zeit getragen hat, sagt Feindt: „Verständnis und Sensibilität für die Vorstellungen der anderen.“